|
Von Schweizertauben, Mondtauben, Elmern und der Elbe
Schweizer Farbentauben gehören zu den älteste in der
Literatur erwähnten Farbentauben. Anfangs mit einer Vielzahl von
Farbenschlägen, die später in der Schweiz teils zu eigenständigen
Rassen wurden. In Frankreich wird die ganze Palette der Färbungen
bis zu La Perre de Roo (1883) unter der
Bezeichnung Schweizer Farbentaube weitergeführt. In Deutschland ist
die Benennung ‚Schweizertaube‘ seit der Schrift von Neumeister 1837
auf Farbenschläge mit einer weiß-atlasartigen Grundfarbe mit rotem
oder gelbem Halbmond und Binden beschränkt. Vor etwa 100 Jahren gab
es eine Diskussion (Wittig/Gimmel 1926) um den Namen der Mondtaube
und die Benennung und Herkunft ähnlicher Varianten wie der Elbe, die
den deutschen Züchtern auch die zwischenzeitliche Entwicklung der
Rassen in der Schweiz aufzeigte. Sie gibt auch heute Anhaltspunkte
für die Entstehung und Beziehungen der Varianten zueinander.
Schweizertauben im von Rudolff Heußlein auf Deutsch in Zürich
herausgebrachten Vogelbuch von Conradt Geßner 1557
Genannt als heimische Taubenfärbungen werden von Heusslein 1557
Weiße, Kohlschwarze, heute Farbenschläge unter den einfarbigen
Schweizertauben und Luzerner Einfarbigen, ganz Rote mit weißen
Köpfen und Schwänzen, vielleicht Vorfahren der Thurgauer Mönche, die
allerdings zusätzlich weiße Schwingen haben. Weiße mit farbigen
Schwänzen und Köpfen hat es gegeben. Farbenschwänze gibt es heute
beim Wiggertaler Farbenschwanz, bei dem der Kopf aber weiß bleibt.
Die Weißschwänze von Heußlein findet man beim Berner, Luzerner und
Thurgauer Weißschwanz. Mehlfarbene könnten schon Ahnen der Thurgauer
Mehlfarbenen sein. Nicht auszuschließen, dass es Vorfahren Thurgauer
und Luzerner Elmer waren. Getröpfelt oder Sperberfarben kann sich
auf Katzgraue (Schimmel) bei den Thurgauer Weißschwänzen oder Berner
Gugger beziehen. Auch Tauben mit Federfüßen und Haube hat es
gegeben, ob auch bei den genannten Färbungen in der Schweiz, das
bleibt im Text offen.
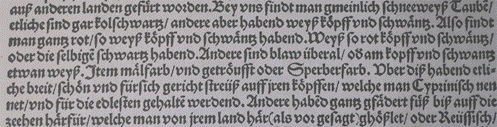
Die Farben Schweizer Tauben zur Zeit Geßners (Quelle: Geßner,
Vogelbuch 1557)
Schweizer Tauben in der französischsprachigen ‚Histoire Naturelle‘
von Buffon 1772
Die Schrift von Buffon wurde schon 1777 ins Deutsche übersetzt.
Beeindruckt haben damals Weiße auf atlasartigen Grund mit einem
rotbraunen ‚Collier‘. Übersetzt mit Halsband, welches auf der Brust
einen gefärbten Harnisch bildet. Bei den heutigen Schweizer
Taubenrassen sind es, als ‚Elmer‘ bezeichnet, Farbenschläge bei
Thurgauer und Luzerner Tauben. Daneben gab es Einfarbige und, aus
der Beschreibung zu entnehmen, auch die späteren Luzerner Gold- und
Kupferkragen. Es wird Buffon bei dem Bildnis des ‚Collier‘ um den
‚Harnisch‘ an der Brust gegangen sein, nicht um ein Halsband.
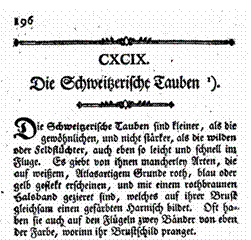 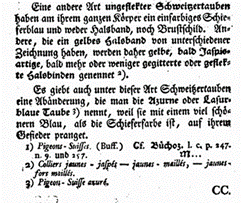
Schweizerische Tauben. Quelle: Übersetzung aus Buffon 1772 ins
Deutsche (1777)
Schweizer Tauben bei Bechstein 1795 und in nachfolgenden Schriften
Die Beschreibung Buffons wird von Bechstein 1795 übernommen.
Der Begriff pflanzt sich in anderen deutschsprachigen
Veröffentlichungen fort, wie bei Leopold 1819.
Auch Boitard und Corbié 1824 im französischen Sprachraum
beziehen sich auf Buffon und stellen die Breite der Farbenschläge
als ‚Pigeon Suisse‘ vor. Die für die meisten Schweizer Farbentauben
heute typische Spitzkappe wird bei ihnen nicht genannt. Das einzige
gezeigte Bild ist eine glattköpfige und glattfüßige
Bronzegeschuppte.
Neumeister
(1837) hat die weiß-atlasartigen Schweizertauben wohl in Natura
gesehen und die Zeichnungen für sein Buch selbst geschaffen. Als
Schweizertauben beschreibt und zeigt er nur die schon von Buffon
herausgehobenen Weiß-Atlasartigen mit farbigen Abzeichen. Die Tauben
seien glattköpfig und belatscht. Er nennt sie auch nicht mehr
Halsbandtaube, eine ihrer Bezeichnungen neben Schweizertaube sei
Halbmondtaube.
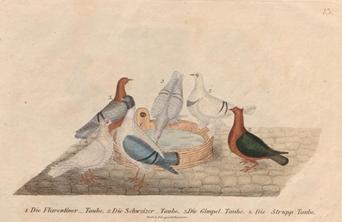
Die Schweizer Taube. Quelle: Neumeister 1837
Von der Halbmondtaube zur atlas-weißen Mondtaube (glattköpfig und
belatscht) und zur gelbfahlen glattfüßigen Elbe oder Schweizertaube
bei Prütz 1885
Schrieb Neumeister noch von einer Halbmondtaube, bezeichnet
Gustav Prütz sie 1885 als Mondtaube. Glattköpfig und stark
belatscht, in zwei Färbungen für Binden und Halbmond, gelblich und
bräunlich rot. Auch wenn im Namen nicht mehr Schweizertaube genannt,
wird mit dem Zusatz C. Helvetiae der historische Bezug hergestellt.
Neben der Mondtaube beschreibt Prütz die ‚Elbe oder Schweizertaube‘.
Die glatten Beine unterscheide sie hauptsächlich von der Mondtaube.
Auch sei der Halbmond der Brust viel größer und mehr nach hinten
verbreitet als bei der Mondtaube.
Der genetisch wesentliche Unterschied geht beim schnellen Lesen der
kurzen Beschreibung unter: Für Prütz ist die Schweizertaube nach der
Umbenennung in ‚Elbe‘ (für hell, licht) eine sehr helle gelb- oder
rotfahle Taube, damit keine Atlasartig-Weiße mehr. Auch ein
eigenständiger und attraktiver Farbenschlag, bei dem – genetisch
bedingt – bei vielen Individuen die Färbung des Halbmondes in den
Nacken hineingeht und zum Halsband werden kann.
Ein Halsband ist keine ungewöhnliche Erscheinung bei Rot- und
Gelbfahlen. Man findet es heute bei Luzerner Gelbfahlen, aber auch
bei hellen Gelb- und Rotfahlen anderer Rassen. Bei Weiß-Atlasartigen
wird das Band durch genetische Modifikatoren offenbar verdeckt.
Vielen Autoren und auch Zeichnern fällt es schwer, ein helles
Gelbfahl von Weiß-Atlasartig zu unterscheiden. Damit lassen sich
auch Zeichnungen von Mondtauben mit rotem Hals erklären, z.B. von
Ludlow im Buch von Fulton 1876 und, identisch übernommen, bei La
Perre de Roo 1883.
   
Mondtaube gelb und Luzerner Elmer auf einer deutschen Ausstellung,
Luzerner Elmer gelbfahl (Zucht und Foto Denis Bülow), Mondtaube
(Swiss or Crescent) von Ludlow bei Robert Fulton 1876
In vielen späteren Abbildungen in der Literatur von Mondtauben mit
einem ausgeprägten Halsband wird es sich genetisch nicht um
weiß-atlasartige Tauben, sondern um sehr helle Gelb- oder Rotfahle
gehandelt haben, wie bei Ludlow 1876 und, identisch übernommen, bei
La Perre de Roo 1883.
Von der Schweizertaube zur Mondtaube mit Stammland Deutschland bei
Schachtzabel 1910
Hatte Prütz mit dem Zusatz C. Helvetiae noch den Ursprung der
Weiß-Atlasartigen mit der Schweiz in Verbindung gebracht, nennt
Schachtzabel auf Tafel 43 für die Mondtaube Deutschland als
Stammland.

Mondtauben rot und gelb in einer Gruppe von Farbentauben: Schwingen-
und Mondtaube sowie Farbentauben mit weißen Binden. Quelle:
Schachtzabel 1910, Tafel 43
Die Mondtaube würde fälschlicherweise auch Schweizertaube genannt.
Die Schweizertaube sei in Deutschland nur noch selten anzutreffen.
Die Grundfarbe der Mondtaube wird als elfenbeinfarbig beschrieben,
die der Schweizertaube als etwas dunkler.
Die Vorstellung Schachtzabels von der ‚Schweizertaube‘ wird nicht
abgebildet, aber kurz beschrieben. Sie sei nicht nur etwas dunkler
als die Mondtaube, auch der Hals zeige keinen Halbmond. Stattdessen
habe sie dort auch einen breiteren Ring, der sich auch auf den
Hinterhals ausdehne. Damit ist er bei der Beschreibung der
gelbfahlen Elbe von Prütz und setzt Schweizertaube und Elbe gleich.
Der Anspruch, Stammland einer Rasse zu sein, oder dem Namen eine
Regionalbezeichnung hinzuzufügen, ist nicht ungewöhnlich. Es kommt
vor, wenn die Rasse im eigentlichen Entstehungsgebiet nicht mehr
gehalten wird, sich regional ein neuer Zuchtschwerpunkt bildet oder
die Rasse in Standardpunkten mehr oder wenig deutlich verändert
wird. Ein Beispiel sind Deutsche Modeneser, Modena und italienische
Triganino Modeneser. Die Nürnberger Bagdette wurde auch nicht in
Nürnberg erzüchtet! In der glattköpfigen und in der stark belatschen
Variante wurde die Schweizertaube in der Schweiz wahrscheinlich
nicht gezüchtet. Zuchtschwerpunkte lagen in Sachsen, Thüringen und
angrenzenden Regionen. Ungewöhnlich ist daher nicht die Umbenennung
von Schweizer Taube in Mondtaube, ungewöhnlich ist es, den durch
Neumeister auch in Deutschland eingeführten Namen ‚Schweizertaube‘
mit einem anderen Farbenschlag (ein helles Rot- oder Gelbfahl mit
farbigen Halsringen) zu besetzen, der zudem nach späteren
Informationen in der Schweiz nicht vorhanden war.
O. Wittig zur Mond- oder Schweizertaube als echt sächsische
Farbentaube
Oswald Wittig
hält in seinem Beitrag über die ‚Mond- oder Schweizertaube‘ im von
ihm herausgegebenen Mustertaubenbuch von 1925 die Bezeichnung als
‚Schweizertaube‘ für unausrottbar. Sie sei eine echt sächsische
Farbentaube, sie werde nur selten außerhalb der weiß-grünen
Grenzpfähle gezüchtet. Unterschieden im Text werden 1. die
belatschte ‚Mond- oder Schweizertaube‘ und 2. die ‚Süddeutsche
Mondtaube oder Goldelbe‘. Letztere glattfüßig und spitzkappig im
Unterschied zur belatschten Mondtaube. Auch gleiche der Halbmond
eher einem Halsring. Über die Herkunft der Goldelbe wüsste selbst
der erfahrene Züchter und Preisrichter A. Bayer nichts anzugeben.
Die Bebilderung ist allerdings nicht mit dem Text abgestimmt.
Gezeigt wird 1. eine belatschte glattköpfige Mondtaube und 2. eine
‚Schweizertaube‘, die in Klammern mit der Goldelbe gleichgesetzt
wird. In der Zeichnung wird aus der Süddeutschen Mondtaube im Text
die Schweizertaube. Und diese mit dem schon bei Prütz angedeuteten
Halsring, der für Prütz typisch für die glattfüßigen Elbe war. So
markant, und als gekünstelt erkennbar, wie hier durch C. Witzmann
gezeichnet, wird Prütz ihn sich nicht vorgestellt haben. Auch die
etwas dunklere Gefiederfärbung kommt in der Abbildung nicht zum
Ausdruck. Angefertigt wurde die Zeichnung wohl für die 1926
herausgegebene deutsche Musterbeschreibung der Tauben, und nicht
nach einem lebenden Vorbild. Offenbar wurden nicht alle Abbildungen
mit der Realität abgeglichen. Auch den schwarzen Thüringer Kröpfer
hatte Witzmann für diese Musterbeschreibung fälschlich mit der
Weißkopfscheckung (Baldhead) der Tümmler gezeichnet (Sell 2021).
 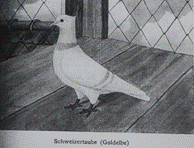 
Mondtaube, gelb, Schweizertaube (Goldelbe) aus dem von O. Wittig
herausgegebenen Mustertaubenbuch, und Thurgauer Elmer gelb (Foto:
Stauber)
Ein Veto aus der Schweiz, Ernst Gimmel jun. aus Arbon am Bodensee in
der Geflügel-Börse 1926
Der Einwand von Ernst Gimmel gegen die Darstellung von Wittig
richtet sich nicht gegen die Umbenennung der Schweizertaube in
Mondtaube, sondern gegen die Darstellung der Goldelbe als
Schweizertaube. Das Bild der spitzkappigen glattfüßigen Goldelbe
entspreche dem Farbenschlag ‚Elmer‘ der Thurgauer Feldtauben, die
Wittig nicht zu kennen scheint. Es sei eine in der Schweiz seit
„undenklichen Zeiten eingebürgerte und gezüchtete Mondtaube, die mit
der Abbildung der Taube (Goldelbe=‘Schweizertaube‘) … genau den Typ,
nicht aber die Halszeichnung gemein hat“. Elmer, weil Tauben mit
dieser Färbung in Elm entstanden seien. Die Färbung der Mondtauben,
wird damit indirekt als schweizerisches Kulturgut reklamiert. Für
eine lange Verankerung in der Schweiz spricht die Nennung der
Färbung bei der Beschreibung der Schweizertaube durch Buffon 1772,
zusammen mit anderen Färbungen, die man bei Schweizer Tauben heute
wiederfindet. Zur Vermeidung einer zu engen Inzucht habe ein
Schweizer Zuchtfreund eine belatschte Mondtaube aus Deutschland mit
Erfolg in die Zucht eingeführt. Wie der genetisch offenbar versierte
Ernst Gimmel feststellt, können Latschen, Spitzhaube und auch
Unterschiede in der Figur schnell an- und abgezüchtet werden. Das
werfe auch die Frage auf, ob die Sächsische Mondtauben tatsächlich
überhaupt nichts mit der schweizerischen Elmertaube zu tun habe, wie
es Wittig zu vermuten scheint. Vielleicht seien die Belatschten aus
der genannten ‚Goldelbe=Schweizertaube‘ herausgezüchtet worden. Ein
Indiz für Zusammenhänge zwischen den Rassen gibt Wittig in der
Diskussion selbst mit dem Hinweis auf ein Inserat, das er bei einer
neuen Recherche in der Geflügel-Börse 1887 gefunden hat. Darin
bietet ein F. Sohlst aus Halle an der Saale gelbliche Elmer oder
Schweizer Täubinnen zum Verkauf an. Der Begriff Elmer war zur
damaligen Zeit also schon in Deutschland geläufig.
Resumé
Bei der Beschreibung der Schweizertauben durch Buffon 1772 handelt
es sich um auch heute noch vorhandene charakteristische
Farbenschläge Schweizer Farbentauben, die teils schon 1557 in der
deutschen Fassung des Vogelbuches von Geßner als in der Schweiz
heimische Tauben erwähnt werden. In Deutschland wurde die
Bezeichnung Schweizertaube durch Neumeister 1837 auf die bei Buffon
hervorgehobenen weiß-atlasartigen Tauben mit einem rotbraunen oder
gelben Halbmond auf der Brust eingeschränkt. Gezeigt belatscht und
glattköpfig. Prütz nennt sie 1885 nicht mehr Schweizertauben und
Halbmondtaube, sondern Mondtaube. Den Namen Schweizertaube (Elbe
oder Schweizertaube) vergibt er an eine Taube mit heller rot- oder
gelbfahler Gefiederfärbung. Neben der Färbung sei ein Unterschied
zur Mondtauben die Glattfüßigkeit und der größere und sich mehr nach
hinten verbreiternde Halsring.
Wohl auch in Unkenntnis der Geschichte und Entwicklung der Schweizer
Rassen, und auch der genetischen Zusammenhänge, wollen Schachtzabel
und Wittig den von Prütz bei der ‚Elbe‘ festgestellten Halsring für
die Schweizertauben als generellen Unterschied zwischen der
deutschen bzw. sächsischen Mondtaube festschreiben. Unterstützt
durch die von C. Witzmann in einer offenkundig nicht nach der Natur
gefertigten Zeichnung für das Mustertaubenbuch festgehalten. Die
Replik aus der Schweiz zeigte, dass die in der Schweiz gehaltenen
Mondtauben unter dem Namen Elber seit ‚undenklichen Zeiten‘ das
Farbmuster der Mondtauben auf weiß-atlasartigen Grund besitzen. Da
sich Spitzhauben, Latschen und Merkmale der Figur schnell an- und
abzüchten lassen, werden enge Beziehungen zwischen den Rassen
bestehen. Damit sei es auch möglich, die belatschte glattköpfigen
Mondtauben auf Schweizer Mondtauben zurückzuführen.
In Deutschland werden heute glattköpfig/belatschte Tauben als
Sächsische und glattköpfige/glattfüßige als Thüringer Mondtauben
unterschieden. Bei den Schweizer Farbentauben gibt es den Thurgauer
Elmer mit Spitzkappen und den Luzerner Elmer mit Spitzkappe und
Bestrümpfung.
Literatur:
Bechstein, Johann Matthäus, Gemeinnützige Naturgeschichte
Deutschlands nach allen drey Reichen, Vierter Band, Leipzig 1795
Boitard, Pierre, et Corbié, Les Pigeons de volière et de colombier
ou histoire naturelle et monographie des pigeons domestiques, Paris
1824.
Buffon, Georges Louis Leclerc de, Herrn von Buffons Naturgeschichte
der Vögel, übersetzt durch F.H.W. Martini, 6.
Band, Berlin 1777.
Buffon, Georges Louis Leclerc de, Oeuvres complètes, Band IV, Paris
1772.
Fulton, Robert, The Illustrated Book of Pigeons, London u.a. 1876.
Gesner, Conrad, Vogelbuch. Darin die art/natur und eigenschafft
aller vöglen / sampt jrer waren Contrafactur / angezeigt wirt: ...
Erstlich durch doctor Conradt Geßner in Latein beschriben: neüwlich
aber durch Rudolff Heüßlin mit fleyß in das Teütsch gebracht / und
in ein kurtze ordnung gestelt, Getruckt zu Zürich bey Christoffel
Froschouwer im Jar als man zalt M.D.LVII (1557)
Ilgen, Horst, und Bernd Herbold, 100 Jahre Sonderverein der
Thüringer Farbentauben. Chronik 1910-2010, Amadeus Verlag,
Sonnenberg 2010.
La Perre de Roo, V., Monographie des Pigeons Domestic, Paris 1883
Leopold, Just Ludwig Günther, Der Taubenfreund oder kurzgefaßter
Gesammtunterricht in der Taubenzucht, Sonderhausen 1819
Neumeister, Gottlob, Das Ganze der Taubenzucht, Weimar 1837
Prütz XE "Prütz" , Gustav, Illustrirtes Mustertaubenbuch,
Hamburg, o.J. (1885)
Schachtzabel, E., Illustriertes Prachtwerk sämtlicher Tauben-Rassen,
Würzburg o.J. (1910)
Sell, Axel und Jana Sell, Genetik der Haustaube, Achim 2025
Sell, Axel, Vorsicht Künstler. Thüringer gemönchte Kröpfer, in:
Verständnis und Missverständnisse in der Taubenzucht. Anekdotische,
unterhaltsame und lehrreiche Anmerkungen zu offenen Fragen, Teil VI,
Achim 2021, S. 24-26
Stauber, Karl, Schweizer Tauben. Herkunft, Zucht, Standard,
Oberentfelden 1996
Wittig, Oswald, Die Goldelbe, Geflügelbörse vom 5. Nov. 1926
(Schriftwechsel mit Ernst Gimmel jun., aus Arbon, Schweiz)
Wittig, Oswald, Unser Hausgeflügel. Zweiter Teil Mustertaubenbuch.
I. Teil: Die Farben und Trommeltauben, Berlin 1925
Anlagen:
 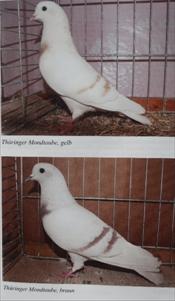
Braun und Gelb,
oder Rot und Gelb.
Sowohl bei den Schweizer wie bei den Deutschen Mondtauben wechselte
die Bezeichnung zwischen Braun und Rot im Schriftgut und in den
Musterbeschreibungen. In der Jubiläumsschrift zum 100-jährigen
Verein der Züchter Thüringer Farbentauben werden die Farbenschläge
noch braun und rot genannt (Ilgen/Herbold 2010). Andreas Leiß hatte
durch Erbversuche bei Thurgauer Elmern festgestellt, dass es sich um
Dominant Rote handelt, die im Grundgefieder durch einen nur bei
roter Grundfarbe wirkenden Modifikator aufgehellt werden.
Quelle: Luzerner Elber rot, Zucht und Foto Denis Bülow, Thüringer
Mondtauben bei Ilgen/Herbold 2010
  
Ähnlichkeiten.
Ähnliche Halszeichnungen bei einer Brieftaube ‚Cherry‘ aus der
eigenen Zucht, einem hellen gelbfahlen Dragoon auf einer Ausstellung
und einer gelbfahlen Luzerner Täubin von Denis Bülow
|